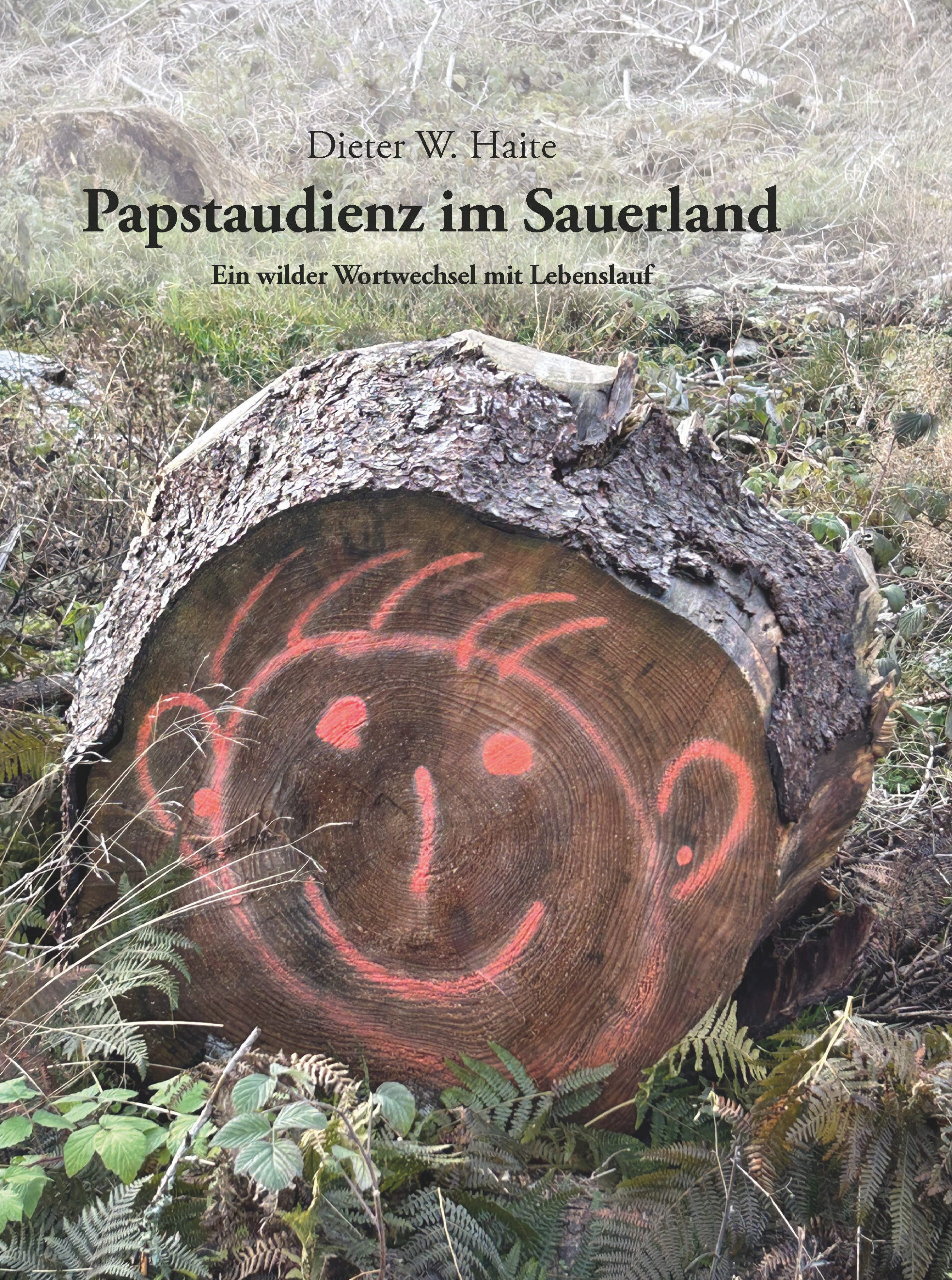Matilda und das Konzert der Bienen – Susanne Köhler

Geflügeltes Westfalen – Schräge Vögel und viele Verse

Abgang eines Baulöwen – Bruno Schmidt

Ein Ort verändert sein Geischt

Von Mondgesicht und Mörder-Paul
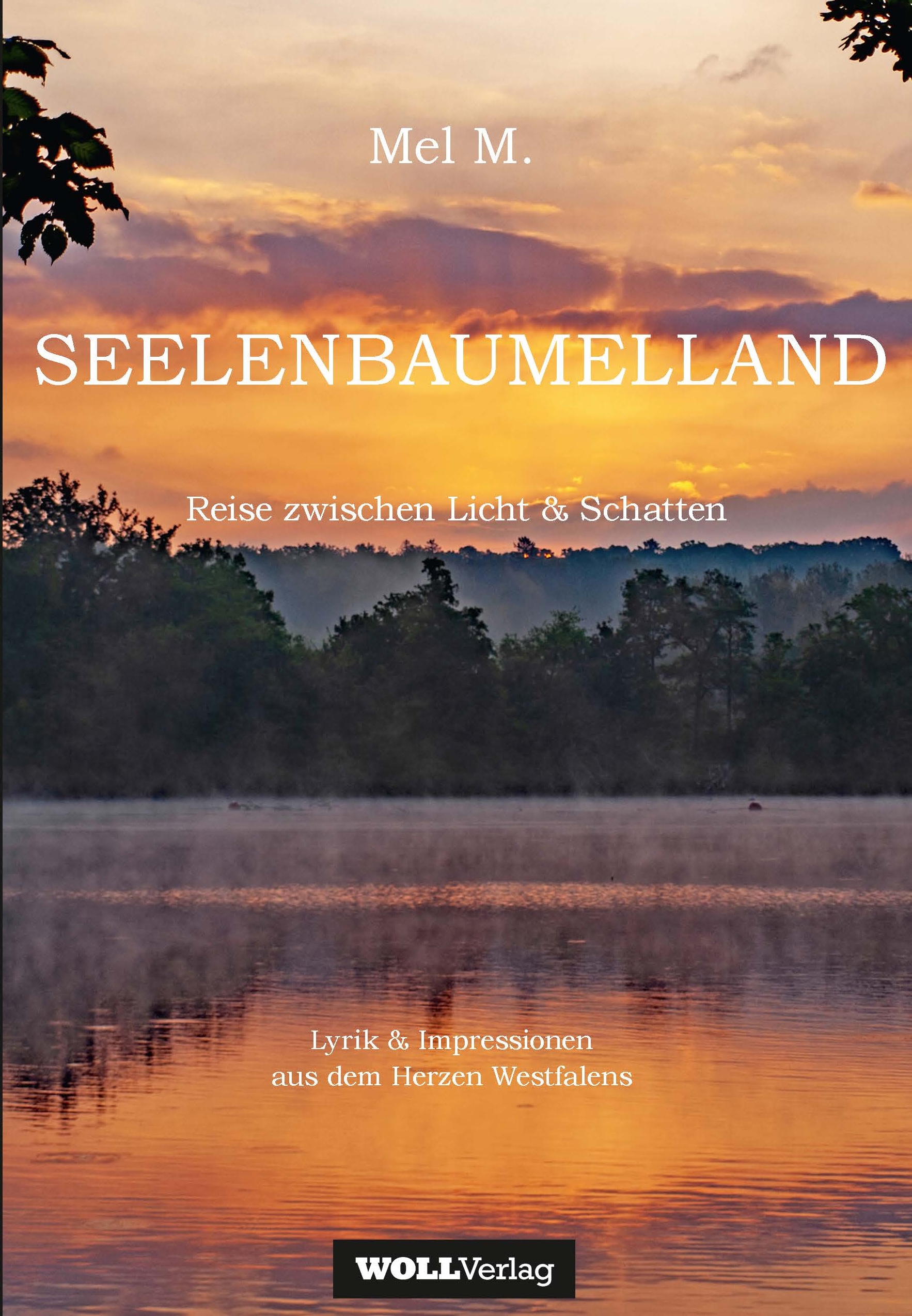
SEELENBAUMELLAND
Das erste Gold des Tages
Wenn das erste Gold des Tages
mit sanften Lippen schlafende Erde berührt.
Feiner Dunst, eine hauchzarte Decke
goldene Landschaft umhüllt.
Wenn dunkle Nacht erwachendem Tage weicht,
Licht dem Schatten eine letzte Umarmung reicht.
Ein Zaubermoment, in welchem mein Herz laut spricht.
Worte fließen leise, meine Seele tanzt in diesem
wunderschönen Morgenlicht.
Ganz bei Dir
Manchmal scheint die Zeit stillzustehen …
Es ist keine Stille, welche dir Angst macht,
dich erdrückt, aus der du ausbrechen möchtest.
Nein, es ist eine Stille,
welche dich wie ein sanfter Mantel umhüllt.
Es ist still …
Du bist ganz bei dir
und nimmst doch alles um dich herum wahr.
Du atmest tief und gleichmäßig,
du fühlst deinen Herzschlag und die Lebenskraft,
die dich durchströmt.
Deine Sinne sind ganz auf Empfang und
doch bist du still und ruhig …
Du spürst den Wind auf deiner Haut.
Deine Nase nimmt den klaren Geruch der Luft
und den würzigen Duft der Wiese,
auf welcher du stehst, auf.
Ein Moment der Stille, indem du ganz bei dir
angekommen bist.
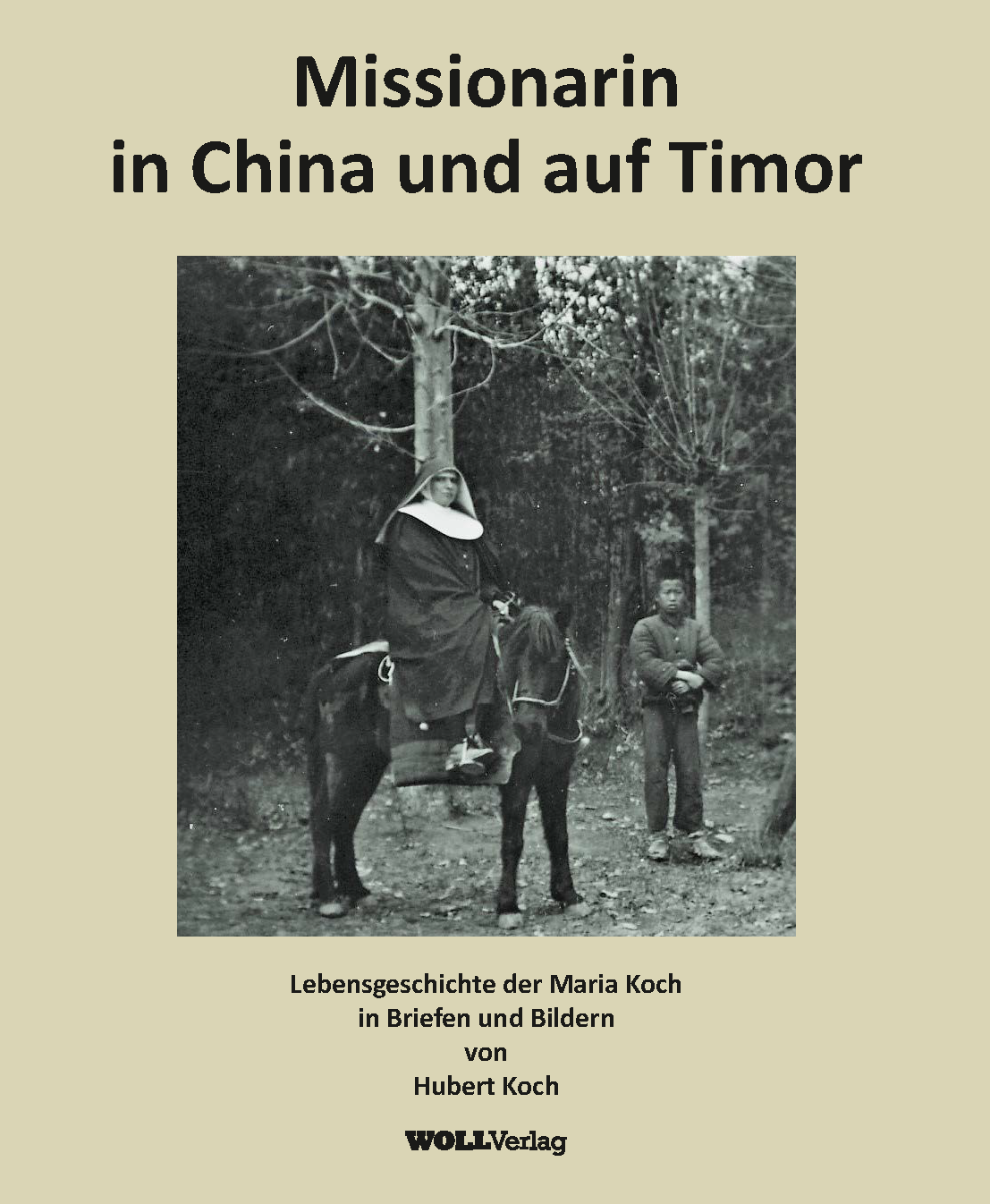
Missionarin in China und auf Timor